In memoriam: H.-W. Krautz: Streiflichter auf Abaelards Collationes
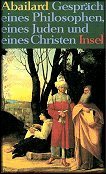
 Der Altphilologe
und Philosoph Hans-Wolfgang Krautz, geb. am 16. Juni 1948, unterrichtete zwei Jahrzehnte lang am altsprachlichen Heinrich-von-Gagern-Gymnasium in Frankfurt a. M. in den Fächern Griechisch, Latein, Deutsch und Philosophie, ehe er zum Sommersemester 2001 als Dozent für alte Sprachen an die Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Evangelische Theologie, berufen wurde. Zu seinen Aufgabengebieten gehörten
die Griechisch- und Hebräischkurse des Fachbereichs, dann auch Übungen zur Originallektüre und Hermeneutik von griechischen, lateinischen und deutschen Quellen
der antiken, mittelalterlichen und neuzeitlichen Philosophie- und Ideengeschichte.
Am 17. Januar 2003 verstarb Herr Krautz allzufrüh im Alter von 54 Jahren.
Der Altphilologe
und Philosoph Hans-Wolfgang Krautz, geb. am 16. Juni 1948, unterrichtete zwei Jahrzehnte lang am altsprachlichen Heinrich-von-Gagern-Gymnasium in Frankfurt a. M. in den Fächern Griechisch, Latein, Deutsch und Philosophie, ehe er zum Sommersemester 2001 als Dozent für alte Sprachen an die Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Evangelische Theologie, berufen wurde. Zu seinen Aufgabengebieten gehörten
die Griechisch- und Hebräischkurse des Fachbereichs, dann auch Übungen zur Originallektüre und Hermeneutik von griechischen, lateinischen und deutschen Quellen
der antiken, mittelalterlichen und neuzeitlichen Philosophie- und Ideengeschichte.
Am 17. Januar 2003 verstarb Herr Krautz allzufrüh im Alter von 54 Jahren.
Hans-Wolfgang Krautz gilt bis dato als der deutsche Abaelard-Übersetzer schlechthin. Aus seiner Feder stammt die meist gelesene deutschsprachige Übersetzung des Briefwechsels, erschienen 1989 innerhalb der gelben Reclam-Reihe: Reclams Universalbibliothek Nr. 3288, Abaelard, Der Briefwechsel mit Heloisa, Stuttgart, 1989. Im Jahre 1995 veröffentlichte er eine zweisprachige Ausgabe von Abaelards Collationes: Abailard, Gespräch eines Philosophen, eines Juden und eines Christen, lateinisch-deutsch, mit einem Essay, Frankfurt, 1995. Weiterhin sind von ihm bei Reclam erschienen: Epikur, Briefe - Sprüche - Werkfragmente, griechisch-deutsch, Stuttgart 1980, und Platon, Protagoras, Griechisch/Deutsch, übers. und komment., Stuttgart 1987. Weitere Publikationen: Kümmert euch nicht um Sokrates, Drei Fernsehspiele von Josef Pieper, Katholisches Filmwerk, Arbeitshilfen, Frankfurt a. M. 1992, und zuletzt: Uriel da Costa, Exemplar humanae vitae/Beispiel eines menschlichen Lebens, lateinisch- deutsch, mit einem Essay, Tübingen 2001.
Noch kurz vor seinem Tode, am 8. Januar 2002, fand unter der Ägide von Hans-Wolfgang Krautz in Frankfurt am Main eine Vortragsveranstaltung deutscher Abaelardübersetzer statt. Es referierten: Dr. U. Niggli, Zürich, zum Thema: Abälard: ein Porträt; Dr. M. Perkams, Jena, zum Thema: Autonomie und Gottesglaube - Abälard als Vorläufer Kants; Dr. R. Peppermüller, Bonn, zum Thema: Erlösung durch Liebe - Abälards Soteriologie; Dr. H.-J. Müller, Frankfurt a. M., zum Thema: Abälards Logik und ihre Anwendung.
Hans-Wolfgang Krautz stellte im Anschluss an diese Veranstaltung dankenswerterweise sein Referat zur Veröffentlichung innerhalb dieser Seiten zur Verfügung:
© Hans-Wolfgang Krautz, 2002
Einsam und ohne nachweisbaren Nachhall im späteren Schrifttum des lateinischen Europa überragen Abaelards Collationes sive Dialogus inter Philosophum, Iudaeum et Christianum, die Vergleiche oder das Gespräch zwischen einem Philosophen, einem Juden und einem Christen, wie ein früher steiler Gipfel nicht nur die Niederungen antagonistisch-triumphalistischer Religionsdispute und Adversus-Traktate, sondern auch den schmalen Höhenzug der beiden anderen großen irenisch-utopischen Religionsgespräche aus der Feder christlicher Philosophen des Mittelalters, Ramon Lulls De gentili et de tribus sapientibus und Nicolaus von Cues' De pace fidei. Um unsere Einschätzung zu begründen, werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf die Entstehung und frühe Überlieferung des Werkes, sodann verorten wir die spezifische Differenz dieses singulären Fragments zu exemplarischen Vertretern jener heterogenen genera litteraria, die allgemein unter dem äquivoken Generaltitel "Religionsdialoge" mehr schlecht als recht zusammengefasst werden. Die Unterscheidung fiction/non-fiction ist hierfür weniger ertragreich als die zwischen zetetischer und persuasiver Rollenprosa. Als prägnanteren Namen für all jene nach Anspruch und Methodik durchaus unterschiedlichen Teilgattungen schlage ich wegen ihrer persuasiven Grundtendenz den Sammelbegriff "apologetische Bekehrungsschriften" vor. Unter sie sind nach meiner Auffassung die insgesamt zetetischen Collationes gerade nicht zu subsumieren. Abälard hat mit ihnen das Niveau der peirastischen Dialektik einiger Untersuchungsdialoge Platons in kongenialer Manier erreicht, ohne die damals in Westeuropa unbekannten griechischen Texte je gelesen zu haben. Vom Plato Latinus kannte er nur den atypischen Timaeus. Anschließend werfen wir von zwei Leuchttürmen aus einige hoffentlich erhellende Streiflichter auf dieses Unikat, das nicht nur ohne direktes Vorbild als Werk sui generis einzig dasteht, sondern auch keine fassbaren Spuren einer ideengeschichtlichen Nachwirkung im europäischen Denken hinterlassen hat. Wir benötigen diese Leuchttürme, um zu verhindern, dass aus der theoretischen Wirkungs- und praktischen Folgenlosigkeit des im Mittelalter singulären Werkes nicht der Fehlschluss gezogen wird, es habe sein Schicksal, nicht beachtet worden zu sein, auch noch verdient. Eher sind wir berechtigt, daraus zu schließen, dass die Zeit für ein angemessenes Verständnis noch nicht reif war.
Als Leuchttürme dienen uns dabei eine spätantike Trostschrift, die das geistige Erbe antiker Philosophie an das Mittelalter weitergegeben hat, gewissermaßen ein allgegenwärtiger Subtext [1] mittelalterlichen Denkens, Boethius' De consolatione philosophiae, und - sozusagen als kommentierender Meta- oder Hypertext - ein Schlüsselwerk aufgeklärter Religions- und Geschichtsphilosophie, Lessings Die Erziehung des Menschengeschlechts. Lessing bedauerte ausdrücklich, dass der Dialogus ebenso wie Sic et Non der Zensur der benediktinischen Herausgeber der theologischen Werke Abälards zum Opfer gefallen war, die sich offenbar entweder um das Seelenheil ihrer Leser oder um die Gunst ihrer Ordensoberen mehr sorgten als um ihre Herausgeberpflichten gegenüber dem Mitbruder. Beinahe wäre er in einem schwachen Moment geistiger Selbstverleugnung darüber zum Benediktiner geworden, "wenn man nur als ein solcher mehr dergleichen Manuskripte zu sehen bekäme." [2] Resignierend hielt er fest, dass "uns doch noch dasjenige Werk des Abälard mangelt, aus welchem die Religionsgesinnungen desselben vornehmlich zu ersehen sein müssten." Umso reizvoller ist es, dieses Werk - die Collationes - mit den Augen Lessings zu lesen, d. h. eine versäumte Lektüre post festum zu simulieren, die wegen kirchlicher Zensur nie stattgefunden hat. Dabei dient uns Die Erziehung des Menschengeschlechts als rezeptionsgeschichtliche Brille, durch deren Perspektiv bzw. aus deren Perspektive der späte Lessing das Werk vermutlich ebenso gelesen hätte wie zuvor die Toleranzschriften des Hieronymus Cardanus. Es ist zu beachten, dass die Werke von Boethius und Lessing jeweils weit über 600 Jahre in Gegenrichtung von den um 1141 abgeschlossenen Collationes entfernt sind. Dass es überhaupt gelingen kann, sinnvoll derlei weit gespannte Brücken zu diesem Werk zu schlagen, spricht schon allein für seinen geistigen Rang. Die Brückenschläge ersetzen uns in einem Akt posthumer Wiedergutmachung an einem lange verkannten oder bewusst totgeschwiegenen und unterdrückten Werk die fehlenden Epochen übergreifenden Sinnhorizonte, d. h. jene verpassten ideengeschichtlichen Anknüpfungspunkte und Traditionslinien, die es im Sinne eines traditionsbildenden Verweisungszusammenhangs aus greifbaren Anspielungen, Zitaten und Auseinandersetzungen für die Collationes so nie gegeben hat. Die Geschichte der Religionstoleranz im Mittelalter ist eine Geschichte von Fehlschlägen.
Die Textüberlieferung der Collationes - so lautet der durch Selbstzitat beglaubigte Titel - geht zurück auf sechs Handschriften, von denen nur drei aus dem Mittelalter, drei aus dem 17. Jahrhundert stammen. Insgesamt fünf Handschriften befinden sich im insularen Wirkungsraum der englischen Sprache, nur eine einzige überwinterte auf dem Kontinent. Bereits diese Tatsachen verweisen einerseits auf die früh einsetzende kontinentale Isolation, andererseits auf das verstärkte Einsetzen einer zumindest stillschweigenden Rezeption der religionsphilosophischen Toleranzschrift von der englischen Spätscholastik bis zur deistischen Frühaufklärung. Verdanken wir dies dem Einfluss Johannes von Salisburys? In England jedenfalls las und benutzte man die Toleranzschrift avant la lettre, ohne sich expressis verbis mit ihr auseinanderzusetzen. Die einzige kontinentale Handschrift V (= Vindobonensis, Wien) aus dem 12. Jahrhundert ist die älteste. Sie präsentiert eine Basisfassung, die vor allem in der Londoner (= L, 13. Jhrdt.) und der ebenfalls mittelalterlichen Oxforder Handschrift B (= Balliol College, 14. Jhrdt.) einige längere oder kürzere Einfügungen erhält. Diese gehen wahrscheinlich zurück auf Abälard selbst und tragen Spuren einer überarbeiteten Spätfassung, die 1140/41 nach seiner Verurteilung auf dem Konzil von Sens im Exil des Klosters Cluny und der Eremitage St.-Marcel in Chalon-sur-Saône entstand. Abt Petrus Venerabilis ließ dort zur selben Zeit unter der Ägide Hermanns von Kärnten eine lateinische Übersetzung des Korans anfertigen. Sie diente der kontroverstheologischen Aufrüstung zum ideologischen Kampf gegen den Islam im Vorfeld des zweiten Kreuzzugs. Petrus Venerabilis verstand wie seine Zeitgenossen den Islam als nestorianische Häresie, die er mit den zwei Büchern seiner Schrift Adversus nefandam sectam sive haeresim Saracenorum geistig niederzuringen hoffte. In einem solchen Umfeld war für ein irenisch-utopisches Gespräch, in dem ausgerechnet die idealisierte Gestalt eines islamischen Apostaten als vernunftethische Vermittlungsinstanz des antiken Tugendkanons an ein reformwilliges Christentum auftrat, keine Verwendung. So verschwand die Handschrift des eigenwilligen Klosterhäftlings nach seinem Tod im Giftschrank des klösterlichen Skriptoriums. Ihr Überdauern trotz allem verdanken wir der anderweitig bezeugten pietätvollen Haltung des geistlichen Nachlaßverwalters Petrus Venerabilis, der den Leichnam Abälards auf Bitten seiner Frau, der Äbtissin Heloïsa, in deren gemeinsame Klostergründung Paraklet überführen ließ. Seine posthume schriftliche Lossprechung des verurteilten Ketzers erhöhte gewiss auch die Erhaltungschance des nachgelassenen Manuskripts.
Was bezweckten die apologetischen Adversus-Schriften in den Augen der christlichen Zeitgenossen? In den Gläubigen der beiden anderen monotheistischen Offenbarungsreligionen, Judentum und Islam, sahen sie Vorläufer oder Abweichler, in jedem Fall mehr oder weniger verstockte Bekehrungsadressaten: in demütiger Ergebenheit und vorauseilendem Gehorsam hatten die Katechumenen einen an Zentraldogmen des Glaubensbekenntnisses ausgerichteten Fragenkatalog abzuarbeiten, der am Ende nur entweder offene Ablehnung mit nachfolgenden Sanktionen oder gläubige Unterwerfung in Form des öffentlich abgelegten Bekenntnisses und der Taufe zuließ. Insbesondere die stereotypen Adversus-Judaeos-Traktate lieferten das Material für Suggestiv- oder Fangfragen, die dann in öffentlichen Disputationen zuvor oft eingeschüchterten Rabbinern zur Stellungnahme vorgelegt wurden: Ist der Messias erschienen oder nicht? Ist er Mensch und Gott zugleich ? Ist die Menschheit durch ihn von ihren Sünden erlöst ? Gilt nach ihm noch die Tora ? etc. Obwohl eigentliche Zwangs- und Schaudisputationen in dieser stereotypen Form gehäuft erst aus dem 13. Jahrhundert belegt sind, mündete bereits das mit tolerantem Sinn (toleranti animo) geführte Religionsgespräch zwischen einem Mainzer Juden und Gilbert Crispin (1046-1117), dem Abt von Westminster und Schüler Anselms von Canterbury, in den alten christlich-jüdischen Streit um den Vorrang des Alten oder des Neuen Bundes, das Auserwähltheitsprivileg, den wahren Messias und in den triumphalistischen Überlegenheitsnachweis für den christlichen Glauben an die Trinität und den Gottmenschen Jesus. Das Dilemma der Missionare war der ubiquitäre Alleinvertretungsanspruch der Kirche auf den wahren Heilsweg, der den Andersgläubigen die Anerkennung ihrer angeblich in die Irre führenden Heilssuche versagte, eine innere Versöhnung damit per se ausschloss und allenfalls noch äußeren Frieden durch einen apologetischen Rückzug hinter die Schranken der eigenen Tradition zuließ. Die drohenden Folgen des unlösbar scheinenden Konflikts waren absehbar: aus Resignation verzichtete man zumal in monastischen Kreisen zunehmend auf einen vernunftgeleiteten Dialog mit anderen Glaubensrichtungen und pochte auf die unveränderte Weitergabe und Annahme der überlieferten Dogmen und Lebenslehren. Es war die Ruhe vor dem Sturm: nach dem inneren geriet unausweichlich auch der äußere Religionsfrieden zunehmend in Gefahr. Judenpogrome und Ketzerverfolgungen im Vorfeld des zweiten Kreuzzugs kündigten sich bedrohlich an. Dafür versuchte Abälard seinem Sohn Astrolabius in folgenden Mahndistichen ( Monita ad Astrolabium, 1138 ) die Augen zu öffnen:
Tot fidei sectis divisus mundus habetur,
Ut quae sit vitae semita vix pateat.
Quod tot habet fidei contraria dogmata mundus,
Quisque facit generis traditione sui.
Denique nullus in his rationem consulere audet,
Dum quacumque sibi vivere pace studet.
So viele Glaubensrichtungen teilen die Welt, wie es heißt,
Dass man kaum noch erkennt, welcher des Lebens Pfad.
Weil entgegengesetzt so viele Glaubensdogmen der Welt,
Handelt ein jeder so, wie sein Volk es tradiert.
Niemand wagt es zuletzt, darin die Vernunft zu befragen,
Während ein jeder noch strebt, sich nur zum Frieden zu leben.
Rationem consulere - die Vernunft befragen: dies war auch noch hundert bzw. dreihundert Jahre nach Abälard das irenisch-utopische Gegenprogramm des Ramon Lull und des Nikolaus von Cues gegen die Religionskriege ihrer Zeit. Anders als Abälard beschränkten sie sich nicht auf die philosophische Suche nach "des Lebens Pfad" (vitae semita), der vom Geröll rivalisierender Glaubensbekenntnisse verschüttet lag, d. h. auf die Suche nach einer vernunftgeleiteten Lebensform als gemeinsamem Heilsweg für alle Menschen. Ihre Ziele waren anspruchsvoller gesteckt. Sie wollten in ihren apologetischen Konkordanzschriften das Christentum mit allen Glaubensartikeln und Lehrinhalten als die wahre Universalreligion vorstellen, unter deren Dach die Menschheit sich auf einen Glauben einigen und so zum endgültigen Religionsfrieden finden könnte. Allerdings inszenieren beide fiktiven Religionsdialoge nicht nur verschiedene dramatische Personenkonstellationen und Schauplätze, sondern entfalten auch sehr unterschiedliche Begründungsverfahren, die auf heterogene philosophische und theologische Bildungsgänge, Denkvoraussetzungen und Begrifflichkeiten zurückzuführen sind.
Lull fingiert ein Treffen dreier Weiser, eines Juden, eines Christen und eines Muslim, die einem verzweifelten Gottsucher, einem Heiden, die Grundlagen ihres Glaubens vorstellen und begründen. Die Dame Intelligentia, ein Sprachrohr für Lulls logisches Regelwerk der Ars combinatoria, führt die drei Gesprächspartner und ihren ungläubigen Zuhörer in die geforderte Methodik der Argumentation ein und bedient sich hierfür angesichts der Landschaftsszenerie der Analogie von den fünf Bäumen und ihren Blüten. Das Begründungsverfahren beruht auf der Lullistischen Korrelativenlehre mit sämtlichen Möglichkeiten der Begriffskombination und ihrer kategorialen Zuordnung. Die Bäume und ihre Blüten repräsentieren die Würdeattribute Gottes, die Tugenden und Todsünden sowie deren Relationen. Dabei spielt die Siebenzahl eine besondere Rolle. Der erste Baum entfaltet die sieben Würdeattribute Gottes: Güte, Größe, Ewigkeit, Macht, Weisheit, Liebe und Vollkommenheit. Der zweite Baum verbindet sie mit den sieben Tugenden, der dritte mit den sieben Todsünden usw. Das einleuchtende Wahrheitskriterium einer theologischen Gotteslehre ist für Lull die größtmögliche Stimmigkeit aller Würdeattribute Gottes untereinander und deren weitestgehende Kompatibilität mit allen sittlichen Qualitäten und Glaubensartikeln der jeweiligen Religion: welcher der drei Weisen die Begriffskombinatorik am vollkommensten entfaltet hat, hat den Wettstreit gewonnen und erhält die Zustimmung des heidnischen Gottsuchers. Dieser ist von den Darlegungen der drei Weisen tief beeindruckt, gibt seine Verzweiflung über den Tod auf und bekennt sich im Gebet zum Glauben an Gott. Seine Wahl will er aber noch nicht offen legen. Auch wenn die drei Weisen ihre jeweiligen Glaubensvoten bereits abgegeben und begründet haben, respektieren sie das Mentalreservat des Heiden und entfernen sich, um sich weiterhin die Suche nach der Wahrheit auf dem Wege des Streitgesprächs in gegenseitiger Achtung und Toleranz offen zu halten.
Der offene Schluss und die logisch einwandfreie Anwendung der Ars combinatoria auf theologische und ethische Grundbegriffe können jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass für den Erfinder der Ars combinatoria, den Autor Lull, allein schon durch die semantische Auswahl seiner Begriffe, die logischen Anwendungsregeln seiner Kategorien und die methodische Architektonik seiner Zuordnungskonstruktionen die Wahrheitsfrage a priori vorentschieden ist. Damit ist auch die einzige Glaubensoption, die einer immanenten Überprüfung ihrer Widerspruchsfreiheit vollständig standhält, für den Heiden bereits im Vorhinein festgelegt. Dieser wird sich früher oder später unter dem zwanglosen Zwang der notwendigen Vernunftgründe (rationes necessariae) für das Bekenntnis zum Christentum entscheiden müssen. Ihm ist allerdings schon im Vorfeld des Bekehrungsgesprächs ein eigener Zugang zum Gottes- und Unsterblichkeitsglauben, zu dem er über eine genuine Gewissensbildung und die Ausprägung eigener Vernunftkategorien hätte allein und aus eigener Kraft finden können, a limine verschlossen geblieben. Lull benötigte einen zumeist stummen und ahnungslosen Bekehrungsadressaten, gewissermaßen eine tabula rasa des rohen Naturzustandes, der offenen Mundes die Begriffsakrobatik der drei Weisen anzustaunen und als reuiger Sünder die Wolke seiner Unwissenheit abzustreifen hatte. In der verhängnisvollen Tradition der spätaugustinischen Lehre von der doppelten Prädestination vertritt er die erbsündliche Verzweiflung der ungetauften Menschheit, der massa damnata: "Er vergegenwärtigte sich die zahlreichen Völker dieser Erde, die sich auf dem Weg zum ewigen Feuer befinden, ohne davon zu wissen, wohin sie aufgrund des Mangels an Gnade gelangen. Dies alles hielt sich der Heide vor Augen, und es überkam ihn Mitleid mit seinen Eltern, Verwandten und Bekannten, sowie mit all jenen, die gestorben sind und das ewige Heil Gottes verloren haben." [3] An dieser Stelle verdampft die irenische Utopie einer versöhnten Menschheit in der missionarischen Drohbotschaft des ewigen Höllenfeuers.
Einen solchen faux pas hat sich Nicolaus von Cues, in dessen Bibliothek im Spital zu Cues sich noch 10 Sammelhandschriften mit 68 Werken des Katalanen samt eigenhändigen Randglossen befinden, im Rahmen seiner Konkordanzschrift De pace fidei bekanntlich nicht geleistet. Den Cusaner erschütterte die türkische Eroberung von Konstantinopel (1453) mit ihren Exzessen an Grausamkeit so, dass er sich im Himmel des Verstandes (in caelo rationis) zur Jenseitsvision einer christlichen Universalreligion entrücken ließ, um den Zeitgenossen an allen Fronten gegenwärtiger und künftiger Religionskriege das Gedankenmodell einer Übereinstimmung der Religionen (concordantia religionum) rational einsichtig und praktisch verfügbar zu machen. Im Himmel also versammeln sich angesichts des gewalttätigen Ausbruchs die aus dem Leben geschiedenen Vertreter der Weltreligionen und Philosophen vieler Nationen aus Ost und West vor Gottes Thron, flankiert von den Mittlern, dem göttlichen Verbum, den Engeln und den Aposteln Petrus und Paulus, um in einem Konzil die dogmatischen Grundlagen einer Einigung zu diskutieren. Der Vornehmste unter ihnen betet zu Gott: "Du also, der du das Leben und das Sein spendest, bist es, der offensichtlich in den verschiedenen Religionen in unterschiedlicher Weise gesucht und mit vielfältigen Namen genannt wird, weil Du in Deinem wahren Sein allen verborgen und unaussprechlich bleibst. Denn Du, die unendliche Schöpfermacht, bist nichts von all dem, was Du geschaffen hast, und kein Geschöpf kann sich von Deiner Unendlichkeit einen Begriff machen, weil es zwischen dem Endlichen und Unendlichen kein Verhältnis gibt . . . So verbirg Dich nicht länger, o Herr! ... Wenn Du so zu walten Dich herablässest, dann wird ruhen das Schwert, der scheelsüchtige Hass und jedes Leiden, und alle werden einsehen, dass unter der Verschiedenheit der religiösen Bräuche nur eine Religion besteht (una religio in rituum varietate)." [4]
Eigentlich erwartet der heutige Leser nun, dass der Cusaner wie in seinen übrigen Spätschriften dem endlichen Verstandesdenken, das als Unterscheidungsvermögen (vis discretiva) nur mit eindeutig definierten Begriffsoppositionen operieren kann, durch Analogien Zugänge zum Unendlichen, zum verborgenen Gott (deus absconditus), eröffnet, damit sich einer vernünftigen Gesamtschau (visio intellectualis) der Zusammenfall der Gegensätze (coincidentia oppositorum) in der göttlichen Einheit offenbart. Wenn sich im Sinne seiner neuplatonisch inspirierten Philosophie die göttliche Einheit in die Vielheit der Welt entfaltet hat, um sich im Vernunftsubjekt des Menschen wie in einem Mikrokosmos abzubilden und zu spiegeln, bleibt auch ein spekulativer Rückweg und Aufstieg zum Einen über eine Synthesis der Gegensätze in der Vernunft (intellectus) möglich. Der Weg hinauf und der Weg hinab ist derselbe. Gäbe es eine besser geeignete Bewährungsprobe für die Einheitsspekulation des Cusaners als die gegensätzlichen Glaubensaussagen der Religionen? Warum verzichtet er hier auf das ausgearbeitete Instrumentarium seiner Philosophie und übersteigt nicht die exoterische Ebene des Verstandes (ratio) hin zur esoterischen Ebene der Vernunft (intellectus)? Der Hinweis auf die Absurdität eines verborgenen Gottes (deus absconditus) im Angesicht der Himmelsbewohner ist zu vordergründig. Denn gerade die vom Cusaner sorgfältig arrangierte dramaturgische Konstellation des Himmelskonzils und das zitierte Stoßgebet geben den entscheidenden Wink: "So verbirg Dich nicht länger, o Herr !" Der erfahrene Kardinal meint zu wissen, dass ein dauerhafter Religionsfrieden nur durch eine Übereinstimmung der Glaubenaussagen aller Religionen in einem gemeinsamen Bekenntnis zu sichern ist. Nicht der Höhenflug philosophischer Spekulation, sondern eine allen einsichtige theologische Explikation der gemeinsamen Glaubenssätze in einer allgemein zugänglichen Begrifflichkeit soll den intersubjektiv und interkulturell konsensfähigen Konkordanzrahmen eines christlichen Universalbekenntnisses schaffen, außerhalb dessen allenfalls noch geringfügige rituelle Differenzen übrig bleiben. Damit wäre auch ein institutionell garantierbarer Toleranzspielraum unter dem Dach einer Universalkirche gesichert. So wäre etwa das göttliche Wort bereit, den für die anderen Monotheisten anstößigen Begriffsternar Einheit-Gleichheit-Verbindung (unitas-aequalitas-conexio) zur Umschreibung der Trinität aufzugeben und durch die eingängigere Dreiheit Einheit-Diesheit-Identität (unitas-iditas-idemptitas) zu ersetzen, damit die biomorphe Vater-Sohn-Metaphorik der überlieferten Glaubensformel zugunsten einer allseits akzeptablen Einheitsformulierung elegant umschifft werden kann. Neuplatonismus ad usum delphini: damit schafft der routinierte Kardinal mit kirchenpolitischer Diplomatie Kompromissformeln, die den fiktiven Beschluss des Himmelskonzils, die endgültige Einigung erst in Jerusalem zu beschließen, nicht zu einer utopischen Vertagung ad Kalendas Graecas entwerten sollen. Dennoch äußern sich in der Mahnung des offenen Schlusses zwei Vorbehalte. Zum einen sollen die Leser begreifen, dass die streitenden Parteien einen Religionsfrieden im irdischen Brennpunkt der Konflikte, in Jerusalem, erst noch praktisch erringen müssen. Zum andern sollen die Philosophen unter ihnen das Bewusstsein der Differenz zwischen Verstandes- und Vernunftebene theoretisch weiterentwickeln und nach einem Vernunftkonsens der Eingeweihten hinter dem Verstandeskompromiss für die Vielen suchen - im himmlischen Jerusalem. De pace fidei ist ein aus der Not geborenes Gedankenexperiment der Vorläufigkeit und der Uneigentlichkeit. Den eigentlichen Zugang zur Wahrheit über Gott aus der genuinen Methodik der Cusanischen Spätphilosophie darf der Leser hier nicht zu finden hoffen.
Es war ein weiter Anstieg von den Niederungen der polemischen Adversusschriften und der asymmetrischen Religionsgespräche auf der Ebene der interreligiösen Konfliktzonen zum Höhenzug der beiden irenisch-utopischen Konkordanzschriften. Sie teilen mit Abaelards Collationes das Schicksal ihrer praktischen Folgenlosigkeit und ihrer verzögerten Rezeption in der Neuzeit. Auch wenn sie einander an Reflexionshöhe, Originalität und irenischer Paränetik in nichts nachstehen, so bleibt doch neben den andersartigen Theorieansätzen zu beachten, dass die Konkordanzschriften Lulls und des Cusaners sich dadurch fundamental von Abälards Dialogus unterscheiden, dass sie beide den Religionsfrieden durch die Bekehrung der Menschheit zu einem gemeinsamen Glaubensbekenntnis anstreben. Dieses Glaubensbekenntnis ist im Kern das christliche. Auf dessen Fundament soll der Bau einer christlichen Universalreligion ruhen. Sie ist institutionell verankert in der Sakramentengemeinschaft der Gläubigen, d. h. in der christlichen Kirche und ihrer Ämterhierarchie. Deshalb haben beide Konkordanzschriften eine gemeinsame kirchenpolitische Zielsetzung. Sie dienen der Missionierung der Andersgläubigen und sollen die Völker einer bekehrten Menschheit unter dem Dach der einen christlichen Kirche des Mittelalters vereinigen. Insofern hat sich der einschränkende Teil unserer Ausgangsthese bestätigt, dass auch die beiden Konkordanzschriften trotz ihrer herausragenden Stellung in letzter Konsequenz zum apologetischen Bekehrungsschrifttum gehören. Warum nun gehören Abälards Collationes nicht zu diesem Genre ?
Abälard klammert jene dogmatischen Fragen, die die notorische Dauerkontroverse zwischen Judentum und Christentum zum ausweglosen Dilemma zu verfestigen drohten, systematisch aus. Entscheidend hierfür ist die Dramaturgie des Gesprächs, die keinen direkten Dialog zwischen dem Juden und dem Christen zulässt, sondern die Mittlerfigur des neopaganen Philosophen dazwischenschaltet, dessen Vernunftanspruch sich beide Vertreter der Schriftreligionen stellen müssen. Der Islam tritt deshalb nicht als Gesetzesreligion, sondern nur in der aufgeklärten Vernunftversion des islamischen Apostaten in Erscheinung, zumal da der Koran damals gerade das erste Mal vollständig ins Lateinische übersetzt wurde und deshalb in der lingua franca des westeuropäischen Mittelalters noch nicht verfügbar war. Zudem genügt der Jude als genuiner Repräsentant für den Typus der Gesetzesreligion. Der gemeinsame Glaube an den einen Gott ist die selbstverständliche Ausgangsbasis des Gesprächs. Es kreist ausschließlich um die Frage nach der richtigen Lebensform, nach einem gemeinsamen Menschheitsethos. Abälard strebt ein gelebtes Menschheitsethos auf der Basis einer vernunftethischen Reform des sittlichen Menschheitserbes in Gestalt der durch den Monotheismus geläuterten Antike, des Judentums und des Christentums an. Alle drei repräsentieren für ihn unterschiedliche monotheistische Glaubensrichtungen (sectae fidei) der einen Menschheit, in denen das menschheitliche Streben nach dem höchsten Gut (summum bonum) und der allgemeine Heilswille Gottes einander begegnen. Haben diese Glaubensrichtungen in seinen Augen einen gleichberechtigten Anspruch auf wechselseitige Toleranz ? Gibt es für Abälard einen Fortschritt im Glauben und im Ethos der Menschheit ? Welche Rolle spielt dabei das Christentum ? Ist es nicht etwa doch auch bei ihm die wahre Universalreligion ? Diese Fragen sollen nun durch eine exemplarische Beleuchtung der Collationes aus zwei Richtungen durch die beiden Leuchttürme Boethius und Lessing vielleicht nicht endgültig beantwortet, aber doch ein wenig geklärt werden.
Aspiciebam in visu noctis - ich schaute in der Erscheinung einer Nacht. Mit diesen Eingangsworten evoziert Abälard die nächtliche Szenerie einer Begegnung der drei Repräsentanten ihrer Glaubensrichtungen (sectae fidei): der Philosoph als Verfechter des natürlichen Sittengesetzes (lex naturalis), Jude und Christ als Anhänger der Schrift (Scriptura). Müde des ständigen Vergleichens und Streitens über ihre Glaubensrichtungen vertrauen sie sich unter der Wortführung des Philosophen dem Schiedsrichter Abälard an, weil er gleichermaßen über philosophische Vernunftgründe (philosophicae rationes) wie über die Kenntnis des Alten und des Neuen Testaments, d. h. die Stützen des Gesetzes (munimenta legis), in Judentum und Christentum verfüge und deshalb den Dauerstreit kompetent zu entscheiden in der Lage sei. Dieser gibt das Kompliment, dank zweier Schwerter - Vernunft und Schrift - seinen Gesprächspartnern mit ihrem einzigen Schwert, der Schrift, überlegen zu sein, gern an den Philosophen zurück und lässt sich ausgerechnet für den Geniestreich seiner Theologia christiana rühmen, die ihm die Verurteilung von Sens (1140) und die Schweigehaft von Cluny eingebracht hat. Das nächtliche Zwiegespräch Abälards mit dem Philosophen entpuppt sich so als Selbstgespräch des in seiner Eremitage vereinsamten Abälard mit seinem Alter Ego. Er knüpft damit deutlich an das nächtliche Zwiegespräch des zum Tode verurteilten Boethius mit der Vision der Philosophia an, die den vereinsamten Gefangenen des Tyrannen Theoderich im Kerker mit dem Verweis auf die Märtyrerphilosophen der Griechen und Römer (Sokrates, Seneca) und auf seine Stellung als Mensch im Kosmos über seine Verzweiflung zu trösten versuchte: "In deiner richtigen Auffassung vom Weltregiment (mundi gubernatione), dass es nämlich nicht von der Blindheit der Zufälle (casuum temeritati), sondern von der göttlichen Vernunft (divinae rationi) abhänge, erkennen wir einen Funken zu deinem Heil (tuae fomitem salutis)." [5] Dieser neuplatonische Grundakkord in der Consolatio philosophiae, das endliche Vernunftwesen Mensch durch seine geistige Teilhabe an der idealen Gesetzmäßigkeit des Kosmos und seines Urhebers an die Unsterblichkeit seiner Seele zu erinnern, um ihn die Verzweiflung an den Leiden dieser Welt vergessen zu lassen, klingt in abgeschwächter Form noch im Dialogus nach. Doch verbürgt das summum bonum in den Augen des neopaganen Philosophen hier zunächst nicht die ideale Ordnung des Universums, sondern primär die universale Geltung des natürlichen Sittengesetzes (lex naturalis) in der Menschheitsgeschichte, das die Exklusivität des Heilsversprechens einer partikularen Religion ausschließt. Sein Verzweiflungsausbruch über die "törichten" Juden und die "wahnsinnigen" Christen gipfelt in den Worten: "Sie macht die Einzigartigkeit ihrer eigenen Glaubensrichtung so anmaßend und hochmütig, dass sie urteilen, wen auch immer sie im Glauben von sich getrennt gesehen hätten, der sei der Barmherzigkeit Gottes entfremdet, und, während alle anderen verdammt seien, sich als einzige selig preisen. Lange habe ich diese Blindheit und diesen Hochmut des Menschengeschlechts betrachtet und mich daher an die göttliche Barmherzigkeit gewandt, indem ich sie demütig und beständig anflehte, dass sie es für wert erachte, mich aus einer so bejammernswerten Charybdis herauszuführen und mich aus solchen Stürmen zum Hafen des Heils zu lenken." [6] Wie ein zweiter Odysseus versucht der Philosoph hier zwischen der Charybdis der einander ausschließenden Heilsversprechungen der Schriftreligionen und der Skylla seiner eigenen Orientierungslosigkeit im Rangstreit der Glaubensrichtungen hindurchzusteuern. Die Schriftreligionen sind offenbar nicht alles, aber ohne sie ist alles nichts. Welche Maßstäbe kann nun der Aufklärer geltend machen, um sich selbst und die einander widersprechenden Schriftreligionen aus der Pattsituation zwischen Autoritäts- und Vernunftglauben herauszuführen ?
Damit sind wir in der Aufklärung, d. h. hier bei Lessing und seiner Schrift Die Erziehung des Menschengeschlechts, angekommen. Ihr zugrunde liegt die Ausgangsthese: "Was die Erziehung bei dem einzelnen Menschen ist, ist die Offenbarung bei dem ganzen Menschengeschlechte." Die §§4/5 entfalten die These: " § 4: Erziehung gibt dem Menschen nichts, was er nicht auch aus sich selbst haben könnte: sie gibt ihm das, was er aus sich selber haben könnte, nur geschwinder und leichter. Also gibt auch die Offenbarung dem Menschengeschlechte nichts, worauf die menschliche Vernunft, sich selbst überlassen, nicht auch kommen würde: sondern sie gab und gibt ihm die wichtigsten dieser Dinge nur früher. § 5: Und so wie es der Erziehung nicht gleichgültig ist, in welcher Ordnung sie die Kräfte des Menschen entwickelt; wie sie dem Menschen nicht alles auf einmal beibringen kann: eben so hat auch Gott bei seiner Offenbarung eine gewisse Ordnung, ein gewisses Maß halten müssen." Gott ist also für Lessing der Garant dafür, dass die Verstandes- und Gemütskräfte des Menschen sich proportional zu den sittlichen Aufgaben entwickeln, die er zu bewältigen hat. Diese Proportionalität verbürgt die Ordnung und das Maß der transzendenten Chancengerechtigkeit. Darunter verstehe ich die unausgesprochene Grundüberzeugung der Aufklärung, dass dem Alten und dem Neuen Bund ein zwischen Gott und Mensch stillschweigend geltendes Fairnessabkommen über die Gerechtigkeit lebensgeschichtlicher Reifungsmöglichkeiten und weltgeschichtlicher Entwicklungschancen vorausliege. Daraus folgt: Kein Mensch, kein Volk und keine Epoche sei auf der jeweiligen Entwicklungsstufe prinzipiell vom Zugang zur Offenbarung und damit zu den Quellen der eigenen Vernunft und Sittlichkeit abgeschnitten. Dank der Gnade der Vernunft gebe es keine Ungnade der frühen Geburt, die die Chance zur Selbsterziehung von vorneherein ausschlösse. Damit stellt sich für den Aufklärer die Frage nach den Stufen und dem Ziel des Entwicklungsfortschritts der Menschheit. Warum bleiben dann aber scheinbar abgelebte Gestalten des religiösen und des sittlichen Bewusstseins dennoch erhalten ? Warum ist es der Menschheit nicht gelungen, Autoritäts- durch Vernunftglauben zu überwinden ?
So wundert sich auch unser Philosoph gleich zu Beginn der Collationes voller Ungeduld über die scheinbare Stagnation der Glaubensentwicklung [7]: "Dies ist nämlich erstaunlich, dass es, obwohl in der Abfolge der Lebensalter und im Fortgang der Zeiten die menschliche Einsicht (humana intelligentia) in allen übrigen Angelegenheiten wächst, im Glauben, in dem die höchste Gefahr des Irrtums droht, keinen Fortschritt gibt." Er empört sich über mangelnden intellektuellen Mut (das sapere aude ! Kants) und blinde Buchstabengläubigkeit bei den Gläubigen der Schriftreligionen, "als bestünde der Glaube eher in einer Äußerung von Worten als im Verständnis der Seele und als sei er mehr eine Sache des Mundes als des Herzens." [8] Deswegen beruft er sich gegen seinen ersten Gesprächspartner, den Juden, auf die Heilssuffizienz des natürlichen Sittengesetzes (lex naturalis), das in der Liebe zu Gott und zum Nächsten bestehe. Darunter versteht er aber überraschenderweise nicht die schenkende Tugend der Selbsthingabe, sondern ganz nüchtern und elementar eine ursprüngliche Synthese zwischen objektiver und subjektiver Gerechtigkeit. Die unbeschnittenen Urpatriarchen Abel, Henoch, Noah bezeugen ihm als Gerechte und Gerechtfertigte der Urzeit die Geltung eines vorabrahamitischen und vormosaischen Urbundes zwischen Gott und Menschheit vor dem jüdischen Ritualgesetz, der Tora. Das Naturrecht (ius naturale) [9] , das die sieben Gebote des noachchidischen Urbundes (z. B. Gott verehren, die Eltern lieben, Übeltäter bestrafen) umfasst, bedarf einer erzieherischen Verankerung in der Tugend der Gerechtigkeit, einem vierfältigen Grundhabitus aus Ehrfurcht, Wohlwollen, Wahrhaftigkeit und Vergeltungsbereitschaft [10] (reverentia, beneficentia, veracitas, vindicatio), um tatsächliche gesellschaftliche Wirkung zu entfalten. Die Ritualvorschriften der Tora, z. B. die Beschneidung, sind für ihn ebenso bloße Figuralvorschriften wie die Kirchengesetze der Christen, z. B. die Taufe. Sie sind temporäre Vorschriften des positiven Rechts (iustitia positiva) zur institutionellen Regelung des Gemeinschaftslebens und deshalb für den genuin Gerechten eine überflüssige Erblast. Mit dem Freiheitsbewusstsein des autonomen sittlichen Individuums lehnt der Philosoph die heteronome Gehorsamkeitshaltung des Juden ab. Sie äußert sich für ihn im Sklavengleichnis, einer jüdischen Vorform der Pascalschen Wette, worin der Jude seinen Gesetzesgehorsam mit seiner präsumptiven Strafangst und seinem präventiven Sicherheitsstreben rechtfertigt. Zuletzt bleibt der Philosoph kopfschüttelnd vor den in seinen Augen selbstquälerischen rituellen Erblasten des Juden stehen, weil sie nicht jene Herzensreinheit und jenes Glück zu garantieren scheinen, die ihm die allein wesentlichen Lebensziele sind.
Lessing dagegen hat viel Verständnis für den "heroischen Gehorsam gegen Gott" (§§ 32/33), zu dem das jüdische Volk in seiner Geschichte erzogen wurde. Denn "Er (sc. Gott) erzog in ihm die künftigen Erzieher des Menschengeschlechts."(§ 18) Damit meint er, dass das Judentum aus dem Kindheitsstadium der "Erziehung durch unmittelbare sinnliche Strafen und Belohnungen" (§ 16) kraft geschichtlicher Erfahrungen wie dem Babylonischen Exil herauswuchs und paradigmatisch für die übrige Menschheit zu einem "veredelten Begriffe von Gott" (§41) fand. Aus dem Nationalgott wurde der Universalgott, Anspielungen und Fingerzeige wiesen voraus auf die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele: "§57: Es war Zeit, dass ein andres wahres nach diesem Leben zu gewärtigendes Leben Einfluss auf seine Handlungen gewönne. §58: Und so ward Christus der erste zuverlässige, praktische Lehrer der Unsterblichkeit der Seele." Daraus entsteht für Lessing "ein neuer Richtungsstoß für die menschliche Vernunft". (§ 63) Diesen Richtungsstoß hat der mittelalterliche Jude im Dialogus längst empfangen. Seinen Glauben an die Unsterblichkeit der Seele sowie an Strafen und Belohnungen im Jenseits sieht er trotz der exegetischen Einwände des Philosophen bereits durch eine richtige Auslegung der Tora bestätigt. Doch versteht er in einer quasi-funktionalistischen Sichtweise die ursprüngliche Absicht der Tora so, dass Gott "durch die Unterweisung irgendwelcher Gesetze die Bosheit zügeln wollte. Andernfalls könnte es leicht so scheinen, als sorge Gott sich nicht um menschliche Angelegenheiten und als werde der Zustand der Welt eher vom Zufall getrieben als von der Vorsehung gelenkt." [11] Speziell die Beschneidung dient für ihn nicht allein als Zeichen der Bundestreue zur sozialen Abgrenzung von den Andersgläubigen, sondern in Analogie zum Gebärschmerz Evas als Erbstrafe der Ursünde Adams, "damit er an jenem Glied zu Recht leide, durch das er in der Verbannung des gegenwärtigen Lebens todgeweihte Kinder erzeugt, weil er durch seine eigene Übertretung sich und uns gleichermaßen aus dem Paradies in die Kümmernisse dieses Lebens hinabstürzt." [12] An dieser sadistischen Konstruktion einer Talionsrache - man denke an Abälards Kastration - ist unschwer zu erkennen, dass Abälard hier in das ansonsten lebensecht gezeichnete Porträt des mittelalterlichen Diasporajuden durch das christliche Theologumenon der Erbsünde selbstquälerische Züge eines welt- und sinnenfeindlichen Christentums hineinprojiziert hat, um insbesondere hyperasketische Anhänger der augustinischen Lehre von der erbsündlichen Konkupiszenz und ihrer Bestrafung indirekt zu kritisieren. Der Jude vertritt hier also nicht als einziger den Typus der autoritätsgläubigen Gesetzesreligion: auch mancher Christ zumal aus dem Klostermilieu gehört dazu. Vielmehr hat der Diasporajude sich auf halbem Wege zumindest gedanklich davon zu lösen versucht und blickt nun selbst - wie Lessing in den §§ 16/23 seiner Schrift - zurück auf seine frühen Vorfahren mit den Augen des Aufklärers, des neopaganen Philosophen, der an die wahre Glückseligkeit als Lohn der Tugend im Jenseits glaubt. Er sieht in ihnen die noch rohe Beute eines göttlichen Fischzugs am Köder eines inzwischen längst überwundenen Diesseits-eudämonismus: "Dass aber der Herr bei der Belohnung des Gesetzes häufiger oder offener irdische als ewige Wohltaten zu erwähnen scheint, dies sei, magst du einsehen, vorrangig geschehen wegen des noch fleischlichen und aufrührerischen Volkes, das er aus der Fülle Ägyptens, über die es unablässig tuschelte, in die raueste Einsamkeit herausführte." [13] Im Folgenden verabschiedet sich der Jude aus dem Gespräch.
Der Philosoph diskutiert nun nach etwa einem Drittel des Dialogs bis zum Abbruch des Fragments nur noch mit dem Christen, wobei er seine anfängliche Gesprächsführung in dem Moment abgibt, in dem er neidlos anerkennen muss, dass der Christ den juristisch-rhetorischen Ausgangstopos von der Überlegenheit des späteren Gesetzes über das frühere durch Vernunftargumente bestätigt hat. Dieser wird zum dialektischen Aufklärer des Aufklärers, weil er den Sieg des Christentums über die antike Philosophie nicht als Sieg der Autorität über die Vernunft deutet wie der Philosoph, sondern dessen Berufung auf Christus als Weisheit Gottes (sapientia Dei) und auf die höhere Vollkommenheit des neuen Gesetzes (Hebr. 7, 18/19) gegenüber dem des Alten Bundes zum Anlass nimmt, Christus auch im Blick auf die griechisch-römische Antike als Vollender der wahren Ethik und als Führer zur sittlichen Vollkommenheit (moralis perfectio) vorzustellen. [14] Dabei fungiert Christus nicht als Erlöser, sondern wie bei Lessing als Lehrer einer neuen Ethik. Einig sind sich die Dialogpartner darin, dass es das Ziel des Lebens sei, das höchste Gut (summum bonum) zu erlangen und das höchste Übel (summum malum) zu vermeiden, und der Weg dorthin in der Vollendung der Tugend bestehe. Der Philosoph identifiziert nun , wie ihm der Christ nachweist, das summum bonum hominis, die wahre Glückseligkeit, zu Unrecht mit dem summum bonum selbst, d. h. mit Gott. Er erliegt deswegen der perspektivischen Täuschung des Jenseitseudämonismus und verwechselt die Folge mit der Ursache, weil er Glückseligkeit als moralisch geschuldeten Lohn der Tugend definiert und die Ranghöhe der Tugenden innerhalb des antiken Kanons so nivelliert, dass deren unterschiedliche Ziele durcheinander geraten: er identifiziert am Ende Epikurs Lustdefinition, die Meeresstille der Seele, mit dem neutestamentlichen Königreich der Himmel. Die Elenxis des Christen setzt an der stoischen These des Philosophen an, alle Tugenden und alle Laster seien jeweils gleichrangig und bildeten eine Einheit, weil nur der, der über jeweils alle zugleich verfüge, tugend- oder lasterhaft zu nennen sei. Die These wird nicht besser dadurch, dass der Philosoph sie mit dem Satz des Augustinus zu stützen sucht, dass die Liebe alle Tugenden einschließe, so dass derjenige, der sie habe, auch über alle anderen Tugenden verfüge. Denn in ihrem Verhältnis zu den übrigen Tugenden - so wendet der Christ ein - gebe es eine Rang- und Gradabstufung sowie ein wechselseitiges Fundierungsverhältnis. Der einzelne Mensch bestimme und verantworte bereits im Diesseits durch seine Liebesbereitschaft oder Lieblosigkeit seine selbstgewählte Nähe (= Himmel) oder Distanz (= Hölle) zum höchsten Gut des Menschen (summum bonum hominis), der Schau Gottes (visio Dei) im Jenseits. Je stärker die Liebe zu Gott auf dem Wege der Menschenliebe wachse, um so mehr steigere sich bereits in ihr und durch sie die Glückseligkeit. Die Dialogpartner wissen nun: so wie in dieser Welt sittliches Vollkommenheitsstreben ohne innere Haltungsstärke und hellsichtiges Unterscheidungsvermögen, Liebe ohne Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß zum Scheitern verurteilt sind, so gilt für das Jenseits die Umkehrung des Satzes. Klugheit ohne Liebe und die übrigen Tugenden ist die Definition der luziferischen Intelligenz. Deshalb scheidet sie auch aus dem eigentlichen Tugendkanon aus. Das rechte Maßverhältnis von vertikaler Spannung und horizontaler Bodenhaftung, Werthöhe und Wertstärke muss derjenige selbst ermessen können, der nach sittlicher Vollendung strebt.
Ohne auf das Schlussdrittel des Dialogs und die darin behandelte Theodizeefrage einzugehen, halten wir vorläufig fest: Grundlage der neuen Ethik ist die alte, Grundlage der Toleranz die Fähigkeit und Bereitschaft aller Anhänger der drei Glaubensrichtungen, einander zu belehren und sich belehren zu lassen, einander zu erziehen und sich erziehen zu lassen. Die gemeinsame Basis ist das natürliche Sittengesetz (lex naturalis), das in der Liebe zu Gott und zum Nächsten besteht. Es hat sich im Laufe seiner Entwicklung von einer Binnensolidarität mit dem eigenen Volk und Nationalgott über den naturrechtlichen Menschheitsanspruch auf universale Gerechtigkeit zwischen Mensch und Mensch, Mensch und Gott, zur unbedingten Liebesbereitschaft der Selbsthingabe an den Mitmenschen und an Gott geläutert. Ohne das Fundament und den Fortbestand der früheren Entwicklungsstufen als Menschheitserbe gäbe es keine sittliche Vollendung. So oder ähnlich hätte wohl auch das offene Resümee des Schiedsrichters Abälard ausgesehen, wenn ihm nicht der Tod die Feder aus der Hand genommen hätte.
[1] Nota bene: die Trostschrift des Boethius war für Abälard nicht einfach ein Zitatenfundus wie andere Schriften desselben Autors, aus denen er wie aus einem Steinbruch passende Sätze herausbrechen und in anderen Kontexten im eigenen Sinne weiterverwenden konnte, sondern eine respektheischende Autorität, mit deren gedanklichen Vorgaben er sich grundsätzlich, nicht in Form beliebig herausgegriffener Belegzitate auseinanderzusetzen hatte.
[2]
Hans-Wolfgang Krautz, Peter Abailard, Gespräch eines Philosophen, eines Juden
und eines Christen, Lateinisch und Deutsch, Frankfurt 1995, S. 358
[3] Ramon Lull, Das Buch vom Heiden und den drei Weisen, übers. Th. Pindl, Stuttgart 1998, RUB 9693, S. 54
[4] Nicolaus von Cues, De pace fidei, hrsg. L. Mohler, Leipzig 1943, S. 92 f.
[5] Boethius, Trost der Philosophie, Frankfurt a. M. 1997, itb 1215, S. 51, nach Neitzke
[6] Krautz,
a.a.O., S. 19
[7] Krautz,
a.a.O., S. 17f.
[8] Krautz,
a.a.O., S.19
[9] Krautz,
a.a.O., S. 187
[10] Krautz,
a.a.O., S. 179
[11] Krautz,
a.a.O., S. 27
[12] Krautz,
a.a.O., S. 57/59
[13] Krautz,
a.a.O., S. 73
[14] Krautz,
a.a.O., S. 103/105