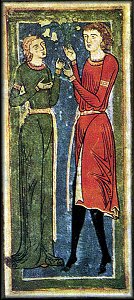Hugo "Primas" von Orléans: Das Lob der Hohen Reimser Schule
Eine dichterischer Denkzettel für Peter Abaelard
© Dr. Werner Robl, April 2003
Die Auseinandersetzung um die Orthodoxie der Lehre Peter Abaelards fand motivischen Einzug in die französische Vagantendichtung des 12. Jahrhunderts. Der bekannteste Vertreter dieses literarischen Genres ist Hugo "Primas" von Orléans. Eines seiner Werke enthält eine versteckte Kritik an der Lehre und Person Peter Abaelards und stellt obendrein die Frage in den Raum, ob dieser nicht eine zeitlang auch in Reims gelehrt haben könnte. Deshalb wird dieses Werk im Folgenden vorgestellt.
Zum Autor
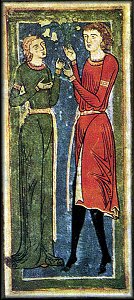 |
Miniatur aus den "Car-
mina burana", Cod.lat.
4660 BSB München:
Ein Vagant mit seiner
Flora. |
Fast alles, was man von Hugo von Orléans weiß, stammt aus den persönlichen Angaben in seinen Gedichten: Kurz vor 1095 scheint er in Orléans geboren worden zu sein. Hugo war somit nur einige Jahre jünger als Peter Abaelard. Nach einer Jugend als Wanderscholar trat er um 1111 in Orléans als Lehrer in Erscheinung. Sein gewaltiges Wissen in den Säkularwissenschaften, insbesondere in der antiken Literatur, verschaffte ihm das ehrende Epithet Primas. Vor allem die Werke Homers und Ovids muss Primas bestens gekannt haben. Der äußeren Erscheinung nach scheint er ein kleiner, hässlicher Mann gewesen sein, der sich selbst in einem seiner Gedichte Zachäus nannte. Sein Lebenswandel scheint nicht dazu angetan gewesen zu sein, ihm eine dauernde Stellung in den Schulen von Orléans zu verschaffen; vermutlich geriet er alsbald als Sarkast und Lästermaul in Verruf. So ging er auf lebenslange Wanderschaft und führte bis zu seinem Tod ein Leben als sogenannter "Goliarde." So nannten sich jene relativ begabten, aber bettelarmen Scholaren - scolares vagantes - oder Wanderkleriker - clerici vagi, die sich keiner festen Ordnung oder dauernden Bleibe unterwerfen wollten und ein freies Vagantenleben mit reichlich Wein, Weib und Würfelspiel - dies sind die drei W eines Vaganten - der Sesshaftigkeit vorzogen. Die Bezeichnung Goliarde liegt etwas im Dunklen; vermutlich hatten sich bestimmte Vaganten in Anspielung auf eine Kunstfigur namens Golias Episcopus (als Verballhornung von Goliath) in einer Art von Zunft zusammengeschlossen und frönten der Dichtkunst, was ihnen einen gewissen Ruf verschaffte. Die bekanntesten Goliarden sind neben Hugo Primas von Orléans auch ein gewisser Primas von Köln, mit dem Hugo bisweilen in einen Topf geworfen wurde, sowie der berühmte Archipoeta.
Den Angaben seiner Gedichte nach hat sich Hugo hintereinander in Le Mans und in Tours, dann kurze Zeit in Amiens und nachfolgend in Reims, zuletzt in Paris, Beauvais und Sens aufgehalten, ohne dass sich hierfür, was schon versucht wurde, feste Zeiträume angeben ließen. Lediglich die Episode in Paris, wo Primas vom hohen Klerus gut aufgenommen wurde, ist durch eine Anfügung zur Chronik des Richard von Poitiers in das Jahr 1142 datiert:
"1142: In diesen Tagen lebte in Paris ein Lehrer namens Hugo, der von seinen Kollegen den Beinamen Primas erhielt, eine kleine Person, hässlich an Gestalt. Er war von Jugend auf in den weltlichen Wissenschaften unterrichtet; durch seinen Witz und seine Literaturkenntnisse war der Ruf seines Namens durch verschiedene Provinzen strahlend verbreitet."
Um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, bot Hugo seine Dienste in den Bischofspalästen, Klöstern und Herrenhöfen an. Für diese erledigte er einige Auftragsarbeiten, wie zum Beispiel das unten stehende Gedicht. Um sich seine Lebenssituation vorzustellen zu können, greift man auf besten auf einige autobiographische Splitter in seinen Gedichte zurück: In Amiens verlor Hugo beim Spiel Hab und Gut, aber der Klerus schenkte ihm das Reisegeld zur Rückkehr nach Reims. In Sens musste er seinen Rock und andere Utensilien verpfänden, ehe er wegen seiner Dienste von Bischof und Archidiakon reichlich entschädigt wurde. Mit dem Bischof von Beauvais stand er dagegen nicht auf gutem Fuß, denn er griff ihn in einem seiner Gedichte heftig an. Hugo scheint auf Einladung auch längere Zeit in England verbracht zu haben, wo allerdings ihm als Weinliebhaber das Bier nicht schmeckte. Hugo war durch den Engländer Richarz, der ihn schon in Sens unterstützt hatte, dorthin eingeladen worden, und es erscheint nicht ausgeschlossen, dass es sich dabei um Richard von Salisbury gehandelt haben könnte. Dass es Hugo Primas im Greisenalter nicht gut ging, belegt er selbst in einigen Gedichten. Die Schilderung seines Aufenthalts in einem Armenhospital gibt nicht nur wertvolle Einblicke auf seine prekäre Situation, sondern auch auf die Lebenssituation der unteren sozialen Schichten in den Städten. Ganz am Ende seines Lebens muss Hugo als mittel- und hilfloser Bettler durch die Lande gestrichen sein, ehe er um die Mitte des 12. Jahrhunderts an unbekanntem Ort verstarb.
Zum Werk
Im Jahr 1907 machte Wilhelm Meyer die um 1200 in Frankreich entstandene Oxforder Handschrift Rawlinson G 109, welche die geschlossenste Sammlung von Hugos Gedichten enthält, in Druckfassung einem größeren Interessentenkreis zugänglich:
W. Meyer: Die Oxforder Gedichte des Primas, in: Nachrichten der Ges. d. Wiss. Göttingen, Phil.-Hist. Klasse, 1907, S. 75-175.
Im Jahre 1961 veröffentlichte Karl Langosch eine Auswahl der Gedichte in deutscher Übersetzung in folgendem Sammelband:
K. Langosch: Hymnen und Vagantenlieder, Lateinische Lyrik des Mittelalters, Darmstadt 1961.
Dass die in der Oxforder Handschrift enthaltenen 23 (nach thematischer Entzerrung eher 27) Gedichte alle aus der Feder des Primas stammen, steht nicht in Zweifel, da der Dichter seinen Namen in nicht weniger als 8 Gedichten in den Vers einfügte. Außerdem zeichnen sich alle durch dieselben Eigenheiten in Form und Inhalt aus, welche den Primas deutlich von den anderen Vagantenlyrikern abheben. Daneben gibt es auch zahlreiche anonyme Fragmente, Epigramme, Memorialverse und Kurzgedichte, die möglicherweise aus der Hand Hugos stammen, aber diesem wegen fehlender Namensnennung nicht sicher zugeschrieben werden können. Stellvertretend soll hier nur ein besonders origineller Zweizeiler angeführt werden, welcher so sehr die Lebendigkeit und Frische von Hugos Dichtkunst reflektiert, dass ihn K. Langosch in seinem obenstehenden Werk eigens erwähnte. Der Hexameter stammt aus einer Bamberger Handschrift, in der über einhundert Zeilen des Primas identifiziert werden konnten.
Nuper - cussus - cepi -la - tenter
Doctor - quetur - ba - ccante - netur
Hier bildet die Schluss-Silbe jedes Wortes den Anfang des nächsten, so dass sich folgender Satz ergibt: Nuper percussus suscepi pila latenter, doctor torquetur turba baccante tenetur.
In der Zeitzer Domherrenbibliothek fand sich folgendes Distichon, welches ebenfalls aus der Hand des Primas stammen könnte:
Primas in scamno non dormivit sine dampno,
Hic inter socios perdidit V. solidos.
Primas schlief auf der Bank nicht ohne Schaden:
Hier unter seinen Kamaraden hat er fünf Sous verloren.
Die lyrischen Werke der Oxforder Handschrift, Epigramme und Vagantenlieder, sind zum Teil nach ihrem Inhalt geordnet oder wegen ähnlichen Inhalts zusammengefasst. Zwei hintereinander stehende Oden aus dem trojanischen Sagenkreis könnten auch Exzerpte aus einem größeren Epos über die Odyssee sein, welches entweder nur bruchstückhaft erhalten blieb oder von Primas aus unbekannten Gründen nicht zu Ende geführt wurde. Das gleiche gilt für drei Gedichte über ein leichtes Mädchen namens Flora. Einige thematisch zusammengehörige Strophen sind aus unklaren Gründen in der Kollektion auf diverse Stellen verteilt, so die Gedichte über Mantel und Pelz.
K. Langosch hat, um Hugos Werk in eine gewisse inhaltliche Ordnung zu bringen, fünf thematische Gruppen gebildet, wobei die Gedichte persönlichen Inhalts die Sammlung einleiten:
- Das erste Gedicht, das älteste der einigermaßen datierbaren, ist eine Auftragsarbeit aus Reims. Es wird weiter unten vollständig vorgestellt werden. Drei weitere fallen in Hugos Greisenalter: ein Gedicht gegen einen Adeligen, der ihn die Treppe hinunterwarf, ein gereimter Angriff auf den Bischof von Beauvais, eine Episode aus einem Kapitelhaus und Armenhospital, in der er einem armen Alten gegen einen überheblichen Kaplan verteidigt und deshalb hinausgeworfen wird, und schließlich der Imarus-Glückwunsch als kleinstes und leichtestes Stück.
- Die zweite Gruppe umfasst ca. die Hälfte aller Gedichte, wobei der größte Teil nur aus paarweisen Hexametern besteht.
- Eine Trilogie befasst sich mit der Dirne Flora.
- Zu den Themen Wein und Würfelspiel finden sich ebenfalls drei Werke. In einem Gedicht von 19 Distichen klagt Primas einen Mann an, der ihn trunken machte, um ihm sein Geld zu entlocken.
- Drei größere, aber fragmentarische Gedichte mit je 51, 59 und 101 Hexametern befassen sich mit antiken Themen und unterscheiden sich von den anderen vor allem dadurch, dass sie nicht auf das Zeitgeschehen eingehen: Orpheus und Eurydike, Troja nach der Eroberung, Odysseus bei Teresias.
Zum Stil
Primas' Lyrik besteht überwiegend aus einem mittelalterlichen Latein, welches temperamentvoll und lebendig vorgetragen wird, sprachlich jedoch stark von der goldenen Latinität abweicht und deshalb nicht immer leicht zu übersetzen ist. Die meisten der ca. 50 Gedichte, die Hugo inzwischen zugeschrieben werden, basieren auf Hexametern, einige auch auf elegischen Distichen. Zusätzlich enthalten sie als mittelalterliches Spezifikum leoninische Halbreime, die auch als sogenannte Unisoni in Reihe auftreten, aber auch endgereimte Caudati und binnengereimte Trinini salientes. Vier größere Gedichte von 90 bis 180 Versen enthalten ausschließlich mittelalterliche Rhythmen: fallende Achtsilbler, steigende Sechssilbler und Alexandriner, oder Stabat-Mater-Strophen. Meistens hält sich der Primas streng an sein vorher gefasstes Konzept, manchmal überschreitet er dieses bewusst und originell - z. B. durch Varianz des Versmaße oder prosaische Einschübe. Zur Förderung des lebendigen Vortrags setzt er die Ausdrucksformen des Volksmunds ein, monologisiert oder dialogisiert häufig, sorgt für rhetorische Einschübe, Anaphern, Alliterationen und Antithesen. Was die Inhalte anbelangt, so nimmt sich der offensichtlich tiefgläubige Hugo kein Blatt vor dem Mund. Er erzählt leidenschaftlich und ungeschminkt, neigt aber auch zu grotesken Übertreibungen und wird manchmal sogar beleidigend oder obszön. Seine zahlreichen altfranzösischen Zwischenrufe und emotionellen Reimtiraden weisen ihn als einen der Muttersprache verbundenen, leidenschaftlichen und heißblütigen Erzähler aus, der es nicht nur versteht, seine originellen Gedanken und Ideen, sondern auch seine innersten Gefühle lebendig zum Ausdruck zu bringen. Alles in allem strahlen die Vagantenlieder des Primas in ihrem abwechslungsreichen Vortrag und ihrer burlesken Szenerie eine derartige Spontaneität und Lebendigkeit aus, dass man ihn ohne weiteres als hochbegabten Weltliteraten in eine Reihe mit F. Villon oder P. Verlaine stellen darf.
Es folgt nun das erste Gedicht aus der Oxforder Sammlung, welches den Titel "Das Lob der Hohen Reimser Schule" erhielt. In ihm darf man Anspielungen auf den Wissenschaftsskandal um Peter Abaelard vermuten. Das hier vorgestellte lateinische Original folgt der Edition W. Meyers (laufende Nummer XVIII), ergänzt um die deutsche Übersetzung K. Langoschs, der gekonnt die Lebendigkeit der Sprache Hugos unter Wahrung von Reim und Rhythmus ins Deutsche transferierte. Das Gedicht selbst weist einen streng symmetrischen Aufbau auf, die Symmetrieachse findet sich bei Vers 57. Zwei Blöcke zu je 24 Zeilen umrahmen den größeren Mittelteil. Zur Erklärung der kunstvollen Konstruktion, finden sich zur Rechten einige Erläuterungen.
Das Lob der Hohen Reimser Schule
| | | |
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
|
Ambianis, urbs predives,
Quam preclaros habes cives,
Quam honestum habes clerum!
Si fateri velim verum,
Sola rebus in mundanis
Hoc prefulges, Ambianis,
Quod nec clerum nec pastorem
Usquam vidi meliorem.
Quam sis plena pietate,
Est ostensum in Primate.
Pauper eram, spoliatus,
Apparebat nudum latus,
Spoliarat me latronum
Seva manus et predonum.
Et qui erant hi latrones?
Deciani tabulones.
Nil habentem in crumena
Remisisti bursa plena.
Ergo Remis, civitatum
Prima tenens principatum,
Tibi mandat per Primatem,
Quod te facit optimatem,
Ut sis una de supremis,
Digna proles sacre Remis.
|
Amiens, du reiche Stadt,
Die die besten Bürger hat,
Die geehrtste Geistlichkeit!
Du strahlst in der Weltlichkeit,
Amiens, wenn ich die Wahrheit
Sagen darf, von solcher Klarheit,
Dass ich nirgends sonst als da
So berühmte Pfarrer sah.
Wie viel Güte in dir steckt,
Ward beim Primas aufgedeckt.
Ich war arm, die Kleidung los,
Und mein Leib erschien ganz bloß;
Meine Habe war ja Beute
Jener schlimmen Räubermeute.
Welche Räuberband es war?
Spieler aus des Decius Schar!
Doch du hast mich heimgeschickt,
Leeren Beutel erst gespickt.
Doch nun Reims, du erste Stadt,
Die den Vorrang innehat,
Dich hebt Primas hoch empor,
Stellt dich in der Großen Chor,
Dass du mit die höchste bist
Und dein Volk dir würdig ist. |
Sechszeiler: Beginnt und endet mit Amiens.
Lob der Amienser Samaritertat.
Autobiographische Splitter, Signatur des Dichters.
Anspielung auf das nachfolgende Reims:
"remis-isti"
Sechszeiler: Beginnt und endet mit Reims.
|
| | | |
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
|
Tante matri, tam preclare,
Obedire, supplicare,
Caput suum exaltare:
Illud erit imperare;
Tantum matrem venerari:
Illud erit dominari.
Remis enim per etatem
Primam tenet dignitatem:
Sed quod habet ab antiquo,
Nunc augetur sub Albrico.
Per hunc Remis urbs suprema,
Per hunc portat diadema,
Per hunc fulget in corona.
Quam commendant multa bona,
Sed pre cunctis hanc divine
Fons illustrat discipline,
Fons preclarus atque iugis,
Fons doctrine non de nugis,
Non de falsis argumentis,
Sed de Christi sacramentis.
Non hic artes Marciani
Neque partes Prisciani,
Non hic vana poetarum,
Sed archana prophetarum,
Non leguntur hic poete,
Sed Johannes et prophete;
Non est scola vanitatis,
Sed doctrina veritatis;
Ibi nomen non Socratis,
Sed eterne trinitatis;
Non hic Plato vel Thimeus,
Hic auditur unus deus;
Nichil est hic nisi sanctum.
Sed in scolis disputantum
Sunt discordes et diversi,
Aberrantes et dispersi:
Quod hic negat, ille dicit;
Hic est victus, ille vicit,
Doctor totum contradicit.
Nos concordes super idem
Confitemur unam fidem,
Unum deum et baptisma.
Non hic error neque scisma,
Sed pax omnis et consensus,
Hinc ad deum est ascensus.
Ergo iure nostra scola
Singularis est et sola.
Scolam dixi pro doctrina:
O mutare possum in a
Et quam modo dixi scolam,
Iam habentem Christi stolam,
Appellare volo scalam.
Hic peccator sumit alam,
Alam sumit, ut ascendat,
Ut ad deum volans tendat.
Hic fit homo dei templum.
Prope satis est exemplum:
Ecce noster Fredericus
Comes comis et amicus,
Et cum eo Adelardus
Valde dives Longobardus;
Generosus puer Oto
Et quam plures pari voto
Hic aggressi viam vite
Sacri degunt heremite;
Per hanc scolam sursum tracti
Sunt celorum cives facti;
Hoc preclaro fonte poti
Modo deo sunt devoti.
|
Solcher Mutter herrlich-schön
Zu gehorchen, sie erhöhn
Und voll Demut ihr zu leben,
Heißt, die Führung ihr zu geben.
Solche Mutter zu verehren,
Heißt, die Herrschaft ihr nicht wehren.
Reims besitzt die höchste Würde
Schon durch seines Alters Bürde;
Doch was früher ihm beschert,
Wird durch Alb'rich jetzt vermehrt,
Der's auf höchste Stufe rückt,
Der's mit einer Krone schmückt,
Der's mit Diadem bekränzt.
Durch wie viel auch Reims erglänzt,
Alles ziert es nicht so sehr
Wie der Quell der Gotteslehr',
Quell, der hell und ewig fließt,
Dem nicht Tand, doch Lehr' entfließt,
Keine falschen Argumente,
Sondern Christi Sakramente.
Nicht die Weisheit des Marcian,
Nicht Grammatik des Priscian
Schätzt man hier, nicht die Poeten,
Doch die Tiefe der Propheten,
Nicht liest hier man die Poeten,
Doch Johannes und Propheten;
Nicht gibt's eitles Wissen dort,
Sondern nur der Wahrheit Wort.
Sokrates wird nicht genannt,
Doch ist Trinität bekannt.
Von dem einen Gott man spricht,
Von Timäus, Plato nicht.
Herrscht das Heilige auch allein,
Stellt sich doch die Zwietracht ein
In den Schulen und der Streit,
Irrtum und Uneinigkeit;
Der sagt ja, wo der verneint,
Der siegt, der besiegt erscheint,
Der Professor anders meint.
Doch wir lassen uns nicht rauben
Eintracht über einen Glauben,
Einen Herrn und eine Tauf:
Dadurch geht's zu Gott hinauf,
Hier gibt's Frieden, doch nicht Irren,
Eintracht, doch nicht Schisma-Wirren.
So steht unsre Schul allein,
dürfte einzigartig sein.
Scola sagte ich für Lehren,
A kann ich in O verkehren:
Was ich eben nannte Scola
(Das besitzt schon Christi Stola),
Ich nun Scala nennen kann.
Sünder nimmt hier Flügel an,
Flügel nimmt er, um zu schweben,
Um im Flug zu Gott zu streben.
Mensch wird hier zum Gotteshaus.
Das reicht doch als Beispiel aus,
Dass ich den Graf Friedrich nenne,
Den ich höflich, huldvoll kenne,
Und mit ihm den Adelhard,
Ein steinreicher Langobard;
Otto, junger Adelsspross,
Und noch mancher sich entschloss,
Nach des Lebens Weg zu streben
Und als Eremit zu leben;
Durch die Schule, durch den Orden
Sind sie Himmelsbürger worden;
Die den klaren Quell gefunden,
Sind seitdem mit Gott verbunden. |
Mittelteil, 69 Verse, eigentliches Loblied.
Erster Teilabschnitt, 32 Verse: 25 - 56.
Zehnzeiler: Preisung der Stadt Reims.
Zehnzeiler: Alberich und seine Theologie:
Je 3 Anaphern: "per hunc" und "fons" gefolgt von Zeilen mit "quam/sed" und "non/sed"
Zeile 39 und 40: Zentralaussage.
Zwölfzeiler: Theologisches Programm der Reimser Schule:
Paarweise positive und negative Aussagen. Rahmen mit "non hic", dazwischen 4 Dyaden mit "non/sed"
Endungen: "poetarum...poete, prophetarum...prophete" gefolgt von einem vierfachen "-is"
Zentralzeile mit Heiligung der Schule und Lehre.
Zweiter Teilabschnitt, 36 Verse: 58-93.
Zwölfzeiler, unterteilt in zwei Sechszeiler.
Sechszeiler: Schulstreit, Negativaussagen, Stabreime, gleiche Reimendungen
Sechszeiler: Abwehr des Schulstreits, Positivaussagen.
Zwölfzeiler: Namenssuche für die Kathedralschule
Endungsschema: 4-4-2-2
Zwölfzeiler: Namhafte Kathedralschüler
Endungsschema: 4-2-2-4
|
| | | |
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117 |
Vos, doctrinam qui sititis,
Ad hunc fontem qui venitis
Audituri Jesum Christum,
Audietis furem istum?
In conventu tam sacrato
Audietur iste Gnato?
Dignus risu vel contemptu,
Cur hoc sedes in conventu?
Nunc legistis Salomonem:
Audietis hunc latronem?
Nunc audistis verum dei:
Audietis linguam rei?
Reus est hic deprehensus,
Verberatus est incensus.
Quod apparet in cocturis,
Que sunt signa capti furis.
Quantum gula sit leccatrix,
Nonne signat hec cicatrix?
Revertatur ad cucullam
Et resumat vestem pullam:
Aut videbo rursus coqui,
Nisi cesset male loqui;
Aut discedat aut taceto
Vel iactetur in tapeto. |
Ihr, die nach der Lehre schmachtet
Und zu Jesus Christus trachtet,
Die ihr zu dem Quell gekommen,
Habt ihr jenen Dieb vernommen?
Hört sich solchen Lebemann
Heiliger Konvent noch an?
Wert, dass Spott und Hohn dich spritzen,
Wagst du in dem Kreis zu sitzen?
Ihr, die Salomo gelesen
Und bei Gottes Wort gewesen,
Wollt das Ohr dem Strauchdieb leihn,
Des Verbrechers Hörer sein?
Schuldig musst er Fesseln tragen,
Ward gebrannt und wundgeschlagen.
Das sieht man noch an dem Brandmal,
Des gefangnen Diebes Schandmal.
Ach, wie eitel schwatzt sein Mund:
Wird's nicht an der Narbe kund?
Er soll heim zur Kutte gehn,
Sich mit schwarzer Tracht versehn!
Noch einmal wird er geschunden,
Hält er nicht sein Maul verbunden.
Still jetzt oder fortbewegt
Oder in den Sarg gelegt! |
Endteil:
Zwölfzeiler: Warnung vor einem unliebsamen Konkurrenten.
Anaphern und rhetorische Fragen: "audietis - audietis - audietis"
Leoninische Reime.
Zwölfzeiler: Verhöhnung des Konkurennten.
Zeile 108-111: 4 rhetorische Fragen. |
Erklärungen zum Inhalt - Bezüge zu Peter Abaelard
Das Gedicht nimmt einen seltsamen Anfang: Obwohl es schwerpunktmäßig der Reimser Theologieschule gewidmet ist, beginnt Hugo mit einer Eloge auf die Stadt Amiens und ihren Klerus, welcher ihn offensichtlich zuvor aus einer Zwangslage befreit hatte, indem er ihm das nötige Wegegeld für eine Rückkehr nach Reims vorgestreckte. Hugo hatte beim Glücksspiel - Decius ist der Gott des Würfelspiels - sein ganzes Hab und Gut verloren. Der erste Sinnabschnitt endet mit einem Wortspiel: Das remis-isti, d. h. du hast mich heimgeschickt, leitet bereits auf das nachfolgende Remis, d. h. Reims, über. Dass Hugo die Großzügigkeit des Klerus von Amiens seinem Panegyrikos an die Theologen von Reims voranstellt, macht literarisch keinen Sinn, wird aber verständlich, wenn man sich die Funktionalität des Werks und seine Zielgruppe vor Augen hält: Indem Hugo auf die spendablen Amienser verweist, winkt er dem Reimser Klerus, dem er das Gedicht gewidmet hat, mit dem Zaunpfahl: Ganz offenkundig erwartet er für seine Lobeshymen auch von ihm einen Lohn. Kein Dichter kann schließlich von der Dichtkunst allein leben!
Die nun folgende Eloge weist Reims die Führungsrolle unter den Städten Frankreichs zu und fokussiert alsbald auf die Lehre der Theologie, wie sie von Archidiakon Alberich von Reims vertreten wurde. Alberich, Leiter der Reimser Domschule zwischen 1118 und 1136, war ein Traditionalist, dem Reformern um Bernhard von Clairvaux nahestehend, und damit ein ausgemachter Gegner der rationalistischen Theologie eines Peter Abaelard. Auf dem Konzil von Soissons im Jahr 1121 ging er aktiv gegen gegen seinen ehemaligen Kommilitonen Abaelard vor. Wenn Hugo nun betont, dass in Reims an den Geheimnissen der Trinität nicht gerüttelt und auf eine Lehre der Säkularwissenschaften, resp. der heidnischen Philosophie, ganz verzichtet werde, schmiert er den innovationsfeindlichen Adressaten seines Gedichts reichlich Honig ums Maul. Die Erwähnung Alberichs gab in der Vergangenheit dazu Anlass, den Terminus ante quem des Gedichts mit 1136 anzugeben, da Alberich in diesem Jahr Reims verließ und als Erzbischof nach Bourges wechselte. Exemplarisch für die Autoren, die in Reims wegen der Heterodoxie der Lehre verachtet oder ignoriert wurden, werden Martian, Priscian, Platon und Sokrates genannt. Es muss schon auffallen, dass es sich hier um Autoren handelte, auf welche Peter Abaelard in seinen Schriften des Öfteren Bezug nahm. Martianus Capella, der Verfasser des im Mittelalter weithin bekannten Werks De nuptiis philologie, wird übrigens in diesen Zeilen als exemplarischer Vertreter der sieben freien Künste, d. h. der Säkularwissenschaften, verpönt, Priscian als wichtigster Grammatiker und Platon und Sokrates als Vertreter der antiken Philosophie. Es erscheint unwahrscheinlich, dass Hugo selbst mit diesen Künsten gehadert hätte. Offensichtlich erfüllte er hier nur gehorsam die Erwartungen seines konservativen Zielpublikums, von dem er sich Lob und Lohn erhoffte.
Es folgt nun der Zentralsatz aus Zeile 57, um den herum das ganze Gedicht konstruiert ist. Er lautet: Es gibt in der Reimser Domschule nur Heiliges! Dies ist eine ebenso lapidare wie unmissverständliche Botschaft.
Damit kontrastiert jedoch sogleich der Hinweis, dass dennoch die puritanische Lehre nicht unumstritten geblieben ist: Es gebe über die Zielrichtung der Theologie einen Wissenschaftsstreit, der die Schulen der Franzia entzweie. Schon diese Textstelle läst an der obigen Datierung zweifeln: Zumindest in seinem offiziellen Teil eskalierte dieser Streit erst weitaus später, nach 1140, durch die Auseinandersetzung zwischen Bernhard von Clairvaux und Peter Abaelard. Alberich von Reims spielte zu diesem Zeitpunkt keine Rolle mehr, er stand kurz vor seinem Tod (Anfang 1141). Hugo erwähnt jedoch sogleich, dass die Orthodoxie der Reimser Schule gegen derartige Spaltungsversuche immun sei und in ihrer Rechtgläubigkeit den einzigen Weg zur Glückseligkeit Gottes aufweise. Zur Untermauerung ihres Rufs nennt Hugo abschließend einige namhafte Adepten, die den Weg des Heils bereits beschritten hätten: Es ist unklar, welche historischen Persönlichkeiten mit Graf Friedrich oder dem reichen Langobarden Adelhard gemeint war. Aber bei dem vornehmen Otto darf man vermuten, dass es sich dabei um den berühmten Historiographen und Neffen Kaiser Friedrichs Barbarossa gehandelt haben könnte, welcher in Frankreich studiert hatte, ehe er Zisterzienser in Morimond und nachfolgend Erzbischof in Freising wurde.
Im Schlussteil bekommt das Bild von der Reimser Schule plötzlich deutliche Risse: Hugo teilt nun bitterböse Seitenhiebe auf einen namentlich nicht genannten Lehrer aus, der offensichtlich bei etlichen Reimser Scholaren Anklang findet und nun vor aller Augen bloßgestellt und lächerlich gemacht werden wird. Schon Ersteditor W. Meyer vermutete, dass es sich dabei um Peter Abaelard gehandelt haben könnte. K. Langosch und C. J. McDonough schlossen sich dieser Ansicht an, wenn auch mit unterschiedlichen Argumenten.
In der Tat ist kein Lehrer der Theologie bekannt, auf den die vom Primas geschilderten Attribute so zugetroffen hätten wie auf Peter Abaelard. Hugo verhöhnt den umstrittenen Mann mit deftigen Worten: Dabei bezieht sich das Reus est hic deprehensus vermutlich auf die Verurteilung Abaelards in Soissons und die anschließende Klosterhaft in Saint-Medard. Das incensus könnte das dortige Autodafé meinen. Wenn der inkriminierte Theologe nun von Hugo als fur und latro, d. h. als Räuber und Dieb bezeichnet wurde, so kann man dies topisch verstehen, etwa im Sinn von "falscher Prophet" oder sogar "Spalter, Schismatiker." Dass in dieser Bedeutung die genannten Begriffe auch von anderen zeitgenössischen Autoren verwendet wurden, hat C. J. McDonough nachgewiesen. All diese Schlagworte entsprachen in der Tat dem Image und Werdegang Abaelards nach seiner ersten Verurteilung in Soissons.
Aus dem Folgenden ist nun zu erkennen, dass ein Teil der Floskeln auch eine sexuelle Konnotation besitzt: Der Ausdruck gula lecatrix, gieriger Schlund, bezieht sich u. E. nicht auf das Sprachverhalten Abaelards, wie es K. Langosch obenstehend übersetzte, sondern am ehesten auf Abaelards frühere Lüsternheit und seine Affäre mit Heloïsa. Dafür spricht auch der nachfolgende Verweis auf ein Brandmal - coctura - bzw. ein Schandmal des Diebes - signum furis -, was man vordergründig als Symbol für Schuld auslegen kann, in Zusammenhang mit der resultierenden Narbe - cicatrix - jedoch eine ganz andere Bedeutung gewinnt: Hugo spielt hier relativ unverhohlen auf die Kastrationswunde Abaelards an! Diese wird, wie damals nicht anders üblich, von dem Arzt, der Abaelard nach der Entmannung behandelte, aus Gründen der Asepsis kauterisiert worden sein! Diese Sicht verweist exakt zurück auf die genannte coctura und auf den captus fur: Abaelard hatte Heloïsa geraubt und war dafür in der Tat auf frischer Tat ertappt und "gebrandmarkt" worden! Das Schimpfwort Gnato, welches Hugo verwendet, weist nun den stärksten Bezug zu Peter Abaelard auf: Si hieß ein Eunuch, der von Terenz als dichterische Figur entworfen worden war! Dass sich die genannten Angaben auf eine frühere Halsverletzung Abaelards und auf die verbreitete Kauterisierung der Schläfen bezogen, wie von W. Meyer und K. Langosch zuvor vermutet, erscheint unter dem geschilderten Blickwinkel unwahrscheinlich.
Einige dieser Details wurden dazu verwendet, dem Gedicht einen Terminus post quem zuzuschreiben: Das Werk müsste nach 1121, d. h. nach dem Konzil von Soissons, entstanden sein. W. Meyer und K. Langosch hielten einen Entstehungszeitraum zwischen 1132 und 1136 am wahrscheinlichsten, C. J. McDonough schloss aus der Tatsache, das in dem Gedicht Alberich von Reims ohne den Titel Archidiakon auftaucht, auf die Jahre zwischen 1118 und 1127. Demnach hätte Abaelard nach seiner Flucht aus Saint-Denis in oder bei Reims gelehrt und der dortigen Domschule Konkurrenz gemacht. Dies klingt zunächst plausibel, wirft aber bei genauerem Hinsehen neue Datierungsprobleme auf:
Denn Peter Abaelard hatte sich nach seiner endgültigen Flucht aus Saint-Denis, die dem Konzil von Soissons folgte, nach Saint-Ayoul in Provins begeben, und es ist nicht von ihm bekannt, dass er dort in Konkurrenz zur Domschule von Reims oder gar in Reims selbst gelehrt hätte. Außerdem hatte zu diesem Zeitpunkt weder de facto noch in Bezug auf sein Verhalten die schwarze Tracht und Kukulle des Benediktinermönchs abgelegt, wie in den letzten Zeilen des Gedichts unterstellt. Für seine spätere Lehrtätigkeit ab 1136 mag dies zumindest im übertragenen Sinn zugetroffen haben; Bernhard von Clairvaux bezichtigte ihn damals, ein monachus sine regula, d. h. ein Mönch ohne Regel, zu sein.
Die letzten vier Zeilen des Gedichts deuten obendrein an, dass der inkriminierte Lehrer mit erneuter Bestrafung zu rechnen habe: Er solle sich in seine Sargdecke einwickeln lassen! U. E. passt diese merkwürdige Drohung viel besser auf die Zeit vor dem Konzil von Sens, als der Vernichtungsfeldzug gegen Abaelard bereits in vollem Gange war. Wenig später lag der Philosoph tatsächlich im Sarg. Hugo Primas könnte demzufolge das Gedicht eventuell erst um 1141 oder noch später verfasst haben, als es darum ging, nach der Sedisvakanz und den Unruhen in den Jahren 1139 und 1140 in Reims die wiedererstarkte Domschule zu fördern. Zur Erreichung des Zwecks konnte Hugo, der Primas, unterschiedliche Szenen aus verschiedenen Zeiträumen kaleidoskopisch verwoben haben, wodurch auch Amiens oder Alberich ihren Platz fanden. Da kurz nach Alberichs Weggang nach Bourges im Jahr 1136 auch Abaelard seine Lehrstätte Saint-Hilaire bei Paris verließ, um ab 1138 an unbekanntem Ort zu lehren, ehe er 1141 verurteilt wurde, könnte er nach Reims gegangen sein. Vielleicht stieß er dort auch auf einen ehemaligen Reimser Lehrer und Kollegen, Walter von Mortagne aus Laon, der in einem Brief an Abaelard ein beiderseitiges Treffen bezeugt. Somit ist es denkbar, wenn auch nicht weiter zu beweisen, dass sich die letzten Zeilen aus Hugos Gedicht auf eine anderweitig nicht dokumentierte Lehrperiode Abaelards in Reims zwischen 1138 und 1141 bezog.
Demnach müsste das ganze Werk auf eine Zeit nach 1141 datiert werden. Sicher ist auch diese Datierung nur eine Spekulation, der man sich nicht unbedingt anschließen muss. Zumindest wird an den geschilderten Widersprüchen deutlich, wie problematisch es ist, aus den Passagen des Gedichts überhaupt auf einen Abfassungszeitpunkt zu schließen. Am Ende wirft das "Lob der Hohen Reimser Schule" doch weitaus mehr Fragen auf, als zunächst angenommen.
Weiterführende Literatur zum Thema
F. Adcock: Hugh Primas and the Archpoet, Cambridge 1994.
J. B. Bauer: Stola und Tapetum - zu den Oxforder Gedichten des Primas, in: Mittellateinisches Jahrbuch 17, 1982, S. 130-133.
M. Billerbeck: Spuren von Donats Terenzkommentar bei H. Primas, in: Rivista di filologia e di istruzione classica 103, 1975, S. 430-434.
F. Cairns: The addition to Richard of Poitiers' Chronica and Hugo Primas of Orleans, Mittellateinisches Jahrbuch 19, 1984, 159-161.
O. Dobiache-Rojdestvensky: Les poésies des goliards, Paris 1931, S. 37-40.
S. Ebbesen: Zu Oxforder Gedichten des Primas Hugo von Orléans, in: Mittellateinisches Jahrbuch 3, 1966, S. 250-252.
W. W. Ehlers: Zum 16. Gedicht des Hugo von Orléans, in: Mittellateinisches Jahrbuch 12, 1977, S. 77-81.
J. de Ghellinck: L'essor de la littérature latine au XIIe siècle, Bd. 2, 1946, 270-272.
Th. Latztke: "Die Mantelgedichte des Primas Hugo von Orléans und Martial", Mittellateinisches Jahrbuch, 5, 1968, S. 54-58.
Karl Langosch: Hymnen und Vagantenlieder, Lateinische Lyrik des Mittelalters, Darmstadt 1961.
Karl Langosch: Profile des lateinischen Mittelalters, Darmstadt 1965.
W. Meyer: Die Oxforder Gedichte des Primas, in: Nachrichten der Ges. d. Wiss. Göttingen, Phil.-Hist. Klasse, 1907, S. 75-175.
C. J. McDonough: Hugh Primas 18: A Poetic Glosula on Amiens, Reims and Peter Abelard, in: Speculum 1986, S. 806-835.
C. J. McDonough: The Oxford Poems of Hugh Primas and the Arundel Lyrics, Toronto 1984.
C. J. McDonough: Hugh Primas and the Bishop of Beauvais, in: MS 45, 1983, S. 399-409.
C. J. McDonough: Miscellaneous notes to Hugo Primas and Arundel 1, in: Mittellateinisches Jahrbuch 14, 1979, S. 187-199.
H. Roos: Zu dem Oxforder Gedicht XVI des Primas, Mittellateinisches Jahrbuch 3, 1966, S. 253-254.
N. Weisbein: Le "Laudes crucis extollamus" de maître H., in: RMAL, 1947, S. 5-26.
N. Weisbein: La vie et l'oeuvre latine de maître H. dit le Primat, Diss. Paris 1945.
J. R. Williams: The cathedral school of Reims in the time of Master Alberic, 1118-1136, Traditio 20, 1964.
Wilmanns, Wilhelm: Das sogen. Namenrätsel des Primas, in: Zeitschrift für das Altertum 16, 1873, 164.
[Zurück zur letzten Seite] [Zum Seitenanfang]